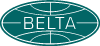Themen
"Zitadellen der Tapferkeit "
Während des Großen Vaterländischen Krieges kämpften die Einwohner hunderter belarussischer Städte und Dörfer gegen den Feind und brachten den Sieg näher. Sechsunddreißig Ortschaften wurden besonders ausgezeichnet und später mit Wimpeln „Für Mut und Tapferkeit im Großen Vaterländischen Krieg“ geehrt. Dieses Abzeichen wurde am 6. Oktober 2004 per Präsidialdekret anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung der Republik von den Nazis eingeführt. Hinter jeder der 36 Zitadellen der Tapferkeit verbirgt sich eine erstaunliche Geschichte von Mut, Heldentum und dem Glauben an den Sieg für alle. Wir werden darüber in unserem neuen Projekt zum 80. Jahrestag der Befreiung von Belarus von den Nazis berichten. Heute berichten wir über die Stadt Djatlowo.
Zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges lebten in Djatlowo etwa 7.000 Menschen. Aber gerade hier waren die deutschen Offiziere im Juni 1941 über den Heroismus der sowjetischen Soldaten erstaunt und nahmen sich die Rotarmisten zum Vorbild für ihre Untergebenen. Während der Besatzung waren in diesem Gebiet sowjetische Partisanen aktiv. Ihre Einheiten agierten geschickt in den tiefen Wäldern von Lipitschansk. Nur die schnelle Offensive unserer Einheiten im Sommer 1944 konnte dem von Kämpfen und Strafaktionen geplagten Land den lang ersehnten Frieden bringen.
Bis zur letzten Patrone
In den ersten Kriegstagen zogen unzählige Autokolonnen und Wagen mit Flüchtlingen und Verwundeten durch den Kreis Djatlowo. Sie wurden von der deutschen Luftwaffe und der Artillerie heftig beschossen. Den Deutschen war es egal, auf wen sie die Bomben abwarfen, ob Kinder oder Soldaten.
„Eine Gruppe aus 14 Rotarmisten verteidigte die Kreisstadt Djatlowo. Ihre letzte Schlacht lieferten sie in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1941. Heute ist uns nur eine Person bekannt - Leutnant Michail Lebedew“, sagt Olga Tjuschlajewa, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Staatlichen Heimatmuseums Djatlowo.

Die Augenzeugen erinnerten sich, dass die deutschen Fallschirmjäger die Straße und die benachbarten Dörfer aus Richtung Kamenka ständig beschossen. Die Anwohner versteckten sich in den benachbarten Siedlungen, Kellern und Kartoffelgruben. Es waren Schüsse zu hören, der Boden bebte von den Einschlägen. Dann ging den Kämpfern der Roten Armee offenbar die Munition aus. Aus Richtung Djatlowo vernahm man „Hurra“-Rufe. Es waren die am Leben gebliebenen Rotarmisten, die in den Nahkampf gingen. Doch die Gegner waren zu viele. Alle vierzehn Verteidiger fielen an ihrem letzten Posten.
„Die Einheimischen wurden gezwungen, die Toten zu begraben. Zu diesem Zweck gruben sie ein großes Grab und brachten sogar einen Priester mit“, erzählt die Museumsmitarbeiterin. „Ein deutscher Offizier stellte die Wehrmachtssoldaten vor der Grube auf und hielt eine Rede über die Helden, die ihn durch ihren Mut dazu zwangen, den Feind mit militärischen Ehren zu begraben.“
Am 30. Juni war der gesamte Kreis Djatlowo besetzt.
Jeden Morgen starben zwei bis drei Kleinkinder
Fünf Tage vor Kriegsausbruch kamen in das örtliche Pionierlager „Nowojelna“ Kinder ausländischer Kommunisten aus dutzend Ländern zur Erholung. Nach dem 22. Juni gab es keine Gelegenheit, sie zu evakuieren. Die Jüngsten gelangten ins Konzentrationslager „Drosdy“. Die Älteren starben unterwegs nach Osten oder fanden Zuflucht bei den Partisanen.
Die übrigen kamen im April 1943 in das Waisenhaus Djatlowo, wo die Deutschen Hunderte von Kindern aus den besetzten Gebieten unterbrachten. Darunter waren Kinder aus den Gebieten Kursk, Orjol und Leningrad. Die armen Kinder wurden von der Lehrerin Walentina Kepp betreut. Sie tat alles, um das schreckliche Schicksal ihrer Schützlinge zu lindern.

„Die kleinen Häftlinge, die zwischen 3 und 13 Jahre alt waren, wurden wie in einem Gefängnis gehalten. Die Verpflegung war karg: Zum Frühstück gab es Tee mit einer Portion Brot, zum Mittagessen irgendeine Wasserbrühe, zum Abendessen Molke. Im Waisenhaus fehlte die Heizung, Typhus und Scharlach grassierten“, schildert Olga Tjuschlajewa schreckliche Details. „Auf dem Friedhof Djatlowo sind 76 Kinder aus dem Waisenhaus begraben, von denen viele nie identifiziert wurden.“
Partisanengebiet - Lipitschanskaja Puschtscha
Massenhinrichtungen, Massaker an der jüdischen Bevölkerung, Besatzungsordnung erzeugten bei den Einwohnern der Region Wut und Hass auf die Faschisten. Im September 1941 entstanden in den Kreisen Djatlowo und Koslowschina die ersten Komsomol-Untergrundzellen. Dort schlossen sich Dutzende von Patrioten zusammen. Im Dorf Satschepitschi, in dem etwa 150 Menschen lebten, bestand der Untergrund beispielsweise aus 11 Kämpfern.
Die Untergrundkämpfer machten Aufklärungsarbeit, verteilten Flugblätter, sammelten Waffen und Medikamente für die Partisanen. Allein aus dem Dorf Jawor übergaben sie in den ersten zwei Jahren der Besatzung fünf Maschinengewehre, mehr als zwanzig Gewehre, Hunderte von Granaten und Minen an die Partisanen. Später halfen sie bei der Sabotage auf der Eisenbahn, beschädigten Telefonverbindungen und verhinderten auf jede erdenkliche Weise, dass junge Menschen zur Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt wurden. Ende 1943 gingen die meisten Untergrundkämpfer aufgrund des zunehmenden Terrors zu den Partisanen.
„Im Dezember 1941 entstanden in der Region Djatlowo mehrere Volksrächer-Gruppen. Am 5. Mai 1942 gründeten sie die erste Partisaneneinheit „Orlanski“, erzählt Olga Tjuschlajewa. „Der Name wurde nicht zufällig gewählt: Am 1. Mai gelang es den Volksrächern, ein deutsches Holzwerk in der Nähe des Dorfes Orlja zu zerstören. Gleichzeitig liquidierten die Partisanen mehrere Kollaborateure und brannten eine Holzbrücke über den Fluss Neman nieder.“
Jeden Tag wurde der Partisanenkrieg härter, faschistische Garnisonen wurden zerstört, wie in den Siedlungen Scheludok und Koslowschina sowie im Dorf Nakryschki. Und am 12. Dezember 1942 wurde im Wald Lipitschanskaja Puschtscha die Lenin-Partisanenbrigade gegründet, die mehr als 800 Kämpfer vereinte. Zu diesem Zeitpunkt verfügte sie über vier Artilleriegeschütze, drei Mörser, einen Panzerwagen und einen Kleinpanzer. Allerdings war nicht immer genügend Munition vorhanden.

Im Jahr 1943 sprang eine NKWD-Sondereinheit „Druschba“ unter der Leitung des legendären Aufklärers Iwan Scholobow mit Fallschirmen über Lipitschanskaja Puschtscha ab. Scholobows Männer haben bisher bereits eine Reihe einzigartiger Operationen im Gebiet Gomel durchgeführt, aber im Kreis Djatlowo war die Lage noch komplizierter. In den Siedlungen befanden sich große deutsche Garnisonen, und die Besatzungsbehörden gaben ihre Versuche nicht auf, Belarussen und Polen, die Seite an Seite lebten, gegeneinander aufzubringen.
„Iwan Scholobow gelang es, aus einer Gruppe von fünfzehn Männer in kürzester Zeit eine große kampffähige Einheit zu bilden“, erzählt Olga Tjuschlajewa. „Ihm ist es zu verdanken, dass mehr als zwanzig feindliche Militärzüge, das Hauptquartier der deutschen Division und Hunderte von Nazis vernichtet wurden.“
Am 25. Februar 1944 wurde in Djatlowo ein antifaschistisches Untergrund-Komitee gegründet. Ihm gehörten Mitglieder des lokalen Untergrunds an: Lehrer, ein Arzt, ein Agronom und sogar eine Priesterfamilie. Das Komitee wurde von Georgi Russin angeführt. Die Antifaschisten unterstützten die Partisanen und organisierten Sabotageakte: Sie sprengten Autos, verbrannten Ernte und zerstörten Brücken.
Es gibt kein Zurück
Im Dezember 1942 führten die Deutschen im Umkreis Djatlowo die Strafaktion „Hamburg“ durch. Dutzende von Siedlungen und Bauernhöfen wurden in Schutt und Asche gelegt. Allein im Dorf Bolschaja Wolja verbrannten sie mehr als hundert Häuser und massakrierten 364 Einwohner: Frauen, alte Menschen und kleine Kinder. Aber was die NS-Bestien am meisten interessierte, war das Partisanen-Krankenhaus, das kurz davor auf einer Insel in der Lipitschanskaja Puschtscha eingerichtet worden war.
Der Standort für das Krankenhaus wurde von Iossif Filidowitsch vorgeschlagen, einem 68-jährigen Bauer, der die Gegend gut kannte. Aber selbst wenn man eine Vorstellung von der Route hatte, war es unmöglich, die Sümpfe zu durchqueren. An den unwegsamsten Stellen musste man spezielle Holzbrücken errichten, die man sofort entfernte.
„Im Dezember 1942 wurde der Wald eingekesselt“, erzählt Olga Tjuschlajewa. „Am 25. Februar 1944 durchsuchten die Deutschen die umliegenden Dörfer auf der Suche nach Verbindungsleuten. Jemand zeigte Filidowitsch an. In der Nacht des 16. Dezember brach ein SS-Trupp in das Haus von Iossif Jurjewitsch ein.
Die Deutschen haben ihm befohlen, ihnen den Weg zur Insel zu zeigen, andernfalls drohten sie, seine Schwiegertochter und seinen Enkelsohn gnadenlos zu töten. Der Alte willigte ein und führte einen 300 Mann starken Trupp sicher in die Sümpfe, an einen der gefährlichsten Orte. Erst nach einigen Stunden, als die Wagen mit Mörsern und Munition im Sumpf zu versinken begannen, ahnten die SS-Männer, dass der Alte sie an den falschen Ort geführt hatte ... Die Leiche von Iossif Jurjewitsch wurde gefunden, als der Schnee auftaute. Er wurde durch mehrere Schüsse in den Hinterkopf getötet worden. In der Nähe wurden die Überreste von mindestens fünfzig Deutschen gefunden, die restlichen Männer wurde nie wieder gesehen.
Das Krankenhaus auf der Insel in der Lipitschanskaja Puschtscha funktionierte bis zur Befreiung der Region im Jahr 1944.

Die rote Flagge wurde gehisst
Am 5. Juli 1944 begann die Belostok-Offensive. Der Kreis Djatlowo wurde von den Kämpfern der 2. Weißrussischen Front unter Generaloberst Georgi Sacharow befreit. Eine Woche zuvor wurde die Stadt Mogiljow befreit. In der Region Grodno setzte die Rote Armee eine neue Taktik ein. Mobile Angriffsgruppen eroberten Übergänge, kleine Siedlungen und wichtige Verkehrsknotenpunkte und hielten sie bis zum Heranrücken der Haupttruppen fest.
Entlang der gesamten Frontlinie kam es zu blutigen Gefechten. Die 120. Schützendivision unter Führung von Generalmajor Jan Vogel stürmte auf Wolkowysk zu. Jan Janowitsch war in den entscheidenden Momenten der Schlacht immer an vorderster Front. Im Dorf Maljuschitschi bei Korelitschi erlitt er eine schwere Verwundung und starb am nächsten Tag. Vogel wurde in Djatlowo begraben. In der Nähe befindet sich das Grab des stellvertretenden Divisionskommandeurs Pawel Petrow, der ebenfalls an seinen Verwundungen starb, allerdings im August 1944. Vor seinem Tod bat er darum, ihn neben dem General Vogel zu begraben.
Am 9. Juli befreite die 283. Schützendivision von Oberst Wassili Konowalow die Kreisstadt Djatlowo. Mit ihr wurden nach einem stürmischen Angriff die Siedlungen Nowojelnja, Nakryschki und Bolschaja Wolja befreit. Über die Stadt Djatlowo wurde die rote Flagge gehisst.
Nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft kam es zu heftigen Gefechten. Bereits am 8. Juli meldete die Luftaufklärung, dass sich deutsches Gerät und feindliche Truppen am linken Neman-Zufluss Moltschad sammelten. In der Nacht zum 9. Juli bombardierten sowjetische Piloten mit einhundert Einsätzen die deutschen Stellungen. Zusammen mit den männlichen Piloten flogen auch die legendären „Nachthexen“ des Luft-Frauenregiments Tamanski unter dem Kommando der Heldin der Sowjetunion Jewdokija Berschanskaja ihre Einsätze.
Am 10. Juli 1944 überschritt die 3. Armee den Fluss Schtschara und zog weiter nach Bialystok.
Der legendäre Partisanenkommandeur und Held der Sowjetunion Fjodor Sinitschkin, der sich 1941 mit seinen Kämpfern tief im deutschen Hinterland befand, ging durch die Dörfer, ohne seine Kampfauszeichnungen abzulegen. Als die Einwohner von diesem furchtlosen Mann erfahren hatten, gingen viel von ihnen in den Wald und schlossen sich seiner Einheit an.
Im Frühjahr 1942 operierten im Umkreis Djatlowo die Partisanengruppen von Walentin Bitko, Pawel Bulak, Nikolai Wachonin, Fjodor Komarow, Wladimir Lebezki, Wassili Pischulin und mehrere andere kleinere Gruppen.
Die Lipitschanskaja Puschtscha ist ein Wald, der sich über die Kreise Djatlowo, Mosty und Schutschin auf einer Fläche von mehr als 15 Tausend Hektar erstreckt.
Straßen tragen ihre Namen

Russin Straße
Georgi Russin wurde im Jahr 1893 geboren. Er schloss die Volksschule Djatlowo mit Auszeichnung ab. Er arbeitete als Lehrer und trat der Kommunistischen Partei von Westbelarus bei. Nach der Vereinigung des Landes war er Schuldirektor und Inspektor der Abteilung für Volksbildung im Kreis Schutschyn. 1941 wurde Georgi Russin im besetzten Gebiet zum Verbindungsmann der ersten Partisaneneinheiten. In deren Auftrag kehrte er nach Djatlowo zurück, bekam eine Stelle in einer Schule und sammelte Informationen. Dabei half ihm seine Tochter Nadja, die als Sekretärin in der Kreisverwaltung arbeitete. Die junge Frau fertigte zusätzliche Kopien der wichtigsten deutschen Dokumente an, die sie an ihren Vater weitergab. Am 30. April kam die Gestapo dem Untergrund auf die Spur, Russin und seine Kameraden wurden gefangen genommen. Nach einem Monat grausamer Folterungen wurden die Patrioten am 1. Juni 1944 hingerichtet. Russins Frau und Tochter landeten in einem Konzentrationslager, aus dem sie am 9. Juli 1944 von der Roten Armee befreit wurden. Die sterblichen Überreste der gefolterten Untergrundkämpfer wurden auf dem Friedhof Djatlowo beigesetzt, 1968 wurde ein Denkmal auf dem Grab errichtet. Eine Straße in Djatlowo trägt den Namen von Georgi Russin.
Bulat Straße
Boris Adamowitsch Bulat wurde 1912 in Tula geboren. Er war Berufsoffizier. Als der Krieg begann, war er Oberleutnant. Am 27. Juni 1941 wurde er schwer verwundet, verlor seine rechte Hand und wurde gefangen genommen. Am 12. September 1941 flüchtete Boris Bulat mit zwei anderen Kriegsgefangenen in den Wald. Eine kleine Gruppe fand Artilleriegranaten, stellte selbstgebaute Minen her und sprengte eine Brücke, über die eine deutsche Dampflokomotive fuhr. Nach und nach wuchs die Partisaneneinheit Nr. 3649 (benannt nach der Nummer der Einheit der Roten Armee, in der Bulat diente). Im April 1942 wurden die Partisanen besonders aktiv: Sie zerstörten eine Garnison in Golynka und demontierten die Eisenbahnlinie in der Nähe des Dorfes Osernizy. Im Dezember 1942 wurde die Einheit von Boris Bulat in der Nähe der Mündung zweier Flüsse Neman und Schtschara umzingelt. Der Kommandeur traf eine gefährliche Entscheidung: Er wollte zum Dorf Ruda Jaworskaja durchbrechen, wo sich das Hauptquartier der Nazis befand. Die Operation war erfolgreich, fast hundert Hitler-Soldaten wurden getötet. Im Dezember 1942 wurde er zum Stabschef der Lenin-Partisanenbrigade gewählt. 1944 wurde Boris Adamowitsch mit dem Titel „Held der Sowjetunion“ ausgezeichnet. Nach dem Krieg leitete Boris Bulat 22 Jahre lang die Süßwarenfabrik „Kommunarka“. Er starb im Jahr 1984 in Minsk. Die Straßen in Grodno, Lida und Djatlowo tragen den Namen des Partisanen.
Bitko Straße
Walentin Bitko wurde 1919 bei Kiew geboren. Er war Berufsoffizier. Als der krieg begann, diente er in Daugavpils in einer separaten Flugabwehrdivision des Baltischen Sondermilitärbezirks. Bitkos Einheit kämpfte seit Begonn des krieges gegen den Feind – sie wehrte deutsche Luftangriffe ab, beseitigte feindliche Landungen. Später feuerten die Flakschützen auf Bodenziele, auf feindliche Panzer. In einer Schlacht wurde Walentin verwundet und musste von den Einheimischen behandelt werden. Nach der Denunziation wurde er in ein Kriegsgefangenenlager gebracht und konnte fliehen. Er fand sich im Dorf Wensowez wieder, wo er Kontakt zu anderen eingekesselten Männern aufnahm und Waffen sammelte. Am 1. Mai 1942 vernichtete Bitkos Einheit das Sägewerk in der Nähe des Dorfes Orlja. Später war Walentin Stepanowitsch mit dem Bau eines Partisanenlazaretts auf einer Insel in der Lipitschanskaja Puschtscha beschäftigt. Ab April 1943 leitete er das Lenin-Partisanenkommando. In weniger als einem Jahr wuchs die Zahl dieser Einheit von 80 auf 200 Personen an. Die Volksrächer organisierten sogar einen speziellen Übungsplatz mit Elementen einer Eisenbahnstrecke, auf dem sie zukünftige Minenleger ausbildeten. Am 8. Juli 1944 schlossen sich die „Lenin“-Männer den regulären Einheiten der Roten Armee an. Walentin Bitko starb 1981. Die Straßen in Djatlowo und Wensowez tragen seinen Namen.
Alexej Gorbunow
Zeitung „7 Tage“