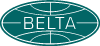Themen
"Zitadellen der Tapferkeit "
Bereits in den ersten Kriegstagen begannen die Bewohner des Kreises Smolewitschi, gegen die Nazis zu kämpfen. Sogar Kinder und Jugendliche schlossen sich dem Kampf an. Bereits im Oktober 1942 wurde hier eine der größten Partisanenformationen des Großen Vaterländischen Krieges gegründet. Die Brigade „Rasgrom“ (Zerschlagung) umfasste sechs Abteilungen und etwa zweitausend Kämpfer.
Die Erde „atmete“ noch lange Zeit
Der Kreis wurde am 26. Juni 1941 besetzt. Unmittelbar im Zentrum von Smolewitschi, wo vor dem Krieg zwei Drittel der Bevölkerung Juden waren, begann man mit der Einrichtung eines Ghettos. Ein im Jahr 2022 errichtetes Denkmal erinnert heute an die Schrecken, die die Einwohner erlitten haben.
- Die Gedenktafel befindet sich direkt gegenüber dem Ort, an dem sich die Wohnzonen für Juden befanden, sagt die örtliche Historikerin Polina Chljupnewa. Sie hat sich viele Jahre lang mit dem Thema Völkermord während des Krieges befasst, indem sie Zeugnisse von Menschen gesammelt und aufbewahrt hat, die während des Großen Vaterländischen Krieges im Kreis Smolewitschi lebten.

Alle dort lebenden Juden mussten einen Kreis auf dem Rücken oder der Brust tragen. Die Deutschen kannten kein Erbarmen mit diesen Menschen. Laut Augenzeugenberichten schlugen sie Frauen und schüttelten Kinder an den Beinen. In das Ghetto wurden nicht nur gebürtige Juden, sondern auch solche, die ihnen ähnlich sahen, geschickt. Anfang August wurden 200 Männer ab 14 Jahren aus dem Ghetto geholt. Sie wurden in einer Reihe aufgestellt und in Richtung des Dorfes Rjabyj Slup (heute ein Stadtteil von Smolewitschi) getrieben. Später waren Schüsse und Granatenexplosionen zu hören. Am nächsten Tag kamen die Einheimischen zum Ort der Tragödie und sahen Keller und Brunnen voller Blut und Leichen – Spuren brutaler Morde.
Anfang September 1941 wurde das Ghetto, in dem noch mindestens 2.000 Menschen lebten, vollständig zerstört. Unter dem Vorwand, nach Smilowitschi gebracht zu werden, wurden die Juden in einer Kolonne aus Smolewitschi abgeführt.
- Wir können nicht genau sagen, wie viele Menschen dort waren. Augenzeugen zufolge bewegte sich die Kolonne jedoch von 8 Uhr morgens bis zum Mittag und war so breit wie die gesamte Perwomajskaja-Straße – von einem Zaun bis zum anderen. „Natürlich gab es keinen Transport nach Smilowitschi. All diese Menschen gingen in den Tod”, sagt Polina Chljupnewa. „Sie wurden zu riesigen Gruben gebracht, wo sie sich bis auf die Unterwäsche ausziehen mussten. Dann wurden jeweils 30 bis 40 Menschen an den Rand der Grube gebracht und erschossen.

Nachdem das Massaker vorbei war, brachten die Deutschen zwei Lastwagen voller Bauern aus dem nächsten Dorf und zwangen sie, die Gruben mit Sand zu füllen. Doch nicht alle waren durch die Kugeln getötet worden, sodass sich die Erde bewegte und „atmete“, bis die Lebendigbegrabenen erstickt waren. Im späten Frühjahr 1943 traf ein Sonderkommando in Smolewitschi ein. Um die Spuren ihrer Verbrechen zu vernichten. Die Nazis öffneten die Grabstätte, gossen Heizöl über die Leichen und verbrannten sie.
Die Untergrundsoldaten wurden gerettet durch... eine Hochzeit
Fast von den ersten Kriegstagen an begann im Dorf Nikolajewitschi im Kreis Smolewitschi eine Untergrundgruppe aus Komsomol-Mitgliedern und Partisanen zu arbeiten. Zunächst handelte es sich um eine kleine Gruppe von nur drei Personen. Laut dem Historiker Alexander Koschel wuchs die Gruppe jedoch innerhalb kurzer Zeit auf 23 Mitglieder an. Koschel lebt selbst im Dorf Sabolotje, wo das Denkmal für den Nikolajewitschi-Untergrund aufgestellt ist. Seit vielen Jahren hält der Lokalhistoriker die Erinnerung an die Helden des Großen Vaterländischen Krieges, vor allem an seine Landsleute, wach.
Zunächst sammelten die Untergrundkämpfer die auf den Schlachtfeldern zurückgelassene Munition ein und brachten sie in ihren Unterschlupf. Später gelang es ihnen, Funkverbindungen herzustellen und Flugblätter zu drucken und zu verteilen. Ihnen ist es zu verdanken, dass ein großes Getreidelager, das für den Transport nach Deutschland vorbereitet worden war, zerstört wurde. Es gab Sabotageakte auf der Eisenbahn und feindliche Züge wurden entgleist. Die Untergrundkämpfer leisteten auch Kriegsgefangenen Hilfe und verhalfen ihnen zur Flucht.
- Die Nazis vermuteten, wer hinter all diesen Sabotageakten steckte, und nahmen sogar den Leiter des Untergrunds Jakow Wassilenko gefangen. Er wurde zehn Tage lang brutal gefoltert, überstand jedoch alle Folterungen und konnte freikommen. Die Überwachung hörte jedoch nicht auf. Um den Deutschen zu entkommen, spielten die Untergrundkämpfer ein ganzes Schauspiel mit einer Hochzeit und Ausflügen zu Pferd, dank dem sie zu den Partisanen gelangen konnten, - sagt Alexander Koschel. - Doch sobald die Nazis merkten, was geschehen war, verhafteten sie die Verwandten des Untergrundführers. Seine Frau wurde in Smolewitschy öffentlich gehängt, seine Mutter wurde erschossen. Fünf weitere Personen wurden ebenfalls hingerichtet.

Waffen des Sieges
Der nächste Punkt auf unserer Route ist ein Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Klennik. Heute befindet sich dort die Gedenkstätte „Rasgrom“ (Zerschlagung), während des Krieges war der Ort jedoch Aufmarschgebiet der gleichnamigen Partisanenbrigade. Wir haben Wiktoria Jurtschuk gebeten, uns durch die örtlichen Orte zu führen. Sie befasst sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Partisanenbewegung im Kreis Smolewitschi.
- Die Partisanenbewegung in unserer Region begann sich buchstäblich in den ersten Kriegstagen zu formieren. Zunächst waren es kleine Gruppen von fünf oder sechs Personen, sagt Wiktoria Jurtschuk. Ende 1941 gab es in Belarus mehr als hundert Partisanenkommandos, auch in unserer Region.

Im Herbst 1942 fand ein historisches Ereignis statt: Die Einheiten „Iskra“, „Rasgrom“ und „Snamja“ wurden zur Brigade „Rasgrom“ vereinigt. Im Sommer 1943 kamen zwei weitere Einheiten hinzu: „Suworow“ und „Rodina“. Später folgte die „Rächer“. Die Brigade operierte in den Kreisen Tscherwensk, Smolewitschi, Borissow und Beresinsk. In ihren sechs Abteilungen zählte die Brigade 1721 Kämpfer, darunter 95 Frauen. Unter den Volksrächern befanden sich auch Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren, die in der Regel wichtige Informationen überbrachten und Dokumente übergaben. Während ihrer Aktionen töteten und verwundeten die Partisanen der Brigade „Rasgrom“ 14.556 Nazisoldaten, zerstörten 29 Panzer, 88 Autos und 17 Geschütze. Zudem brachten sie 287 feindliche Züge zum Entgleisen und sprengten 2 188 Schienen in die Luft.
- Für eine Explosion wurden etwa zehn Kilogramm Munition benötigt. Meistens wurde diese aus im Wald gefundenen Granaten gewonnen. Manchmal gelang es den Partisanen jedoch auch, Waffen und Munition im Kampf gegen die Nazis zu erbeuten. Wenn sich die Gelegenheit ergab, wurde Sprengstoff aus dem Hinterland geschickt, - sagt Wiktoria Jurtschuk.

Die Volksrächer waren auch an der Herstellung von Waffen beteiligt. Eine von erfahrenen Handwerkern der Abteilung „Iskra“ hergestellte Kanone beispielsweise wurde zu einem der ersten Ausstellungsstücke des Museums für die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges. Wir haben Wictoria Alexandrowna nach der Entstehungsgeschichte dieses einzigartigen Stücks gefragt.
- Auf dem Rückweg von einem Einsatz stießen die Partisanen auf einen sowjetischen Panzer, der getroffen worden war. Da sie erkannten, dass dieser nicht repariert werden konnte, bauten sie die Kanone aus und setzten sie im Kampf gegen den Feind ein. Im Sommer stellten sie die Kanone auf die Räder einer Sämaschine und im Winter auf einen Schlitten. Mit dieser Kanone beteiligten sie sich an der Unterminierung von Stellungen und der Niederschlagung von Garnisonen. Die Kanone befindet sich heute im Museum für die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges, sagt die Lokalhistorikerin.
Der Feind wird nicht durchkommen!
Ende Juni/Anfang Juli 1944 fällt in die heißeste Zeit der Operation „Bagration“. Zu dieser Zeit fanden vernichtende Kämpfe statt, um die rund 105.000 Mann starke Armee der deutschen Invasoren zu besiegen, die östlich von Minsk eingekesselt war. Nach und nach verengte sich der Ring und die endgültige Niederlage der Gruppierung fand schließlich auf dem Gebiet des Kreises Smolewitschi statt. Das Zentrum des „Minsker Kessels“ war das Dorf Pekalin. Besonders brutale Kämpfe gab es in der Nähe des Dorfes Wolma, wo sich die Hauptkräfte des Feindes konzentrierten. Die Deutschen bewegten sich entlang der Waldwege in Richtung Studenka – Pekalin – Wolma. Östlich von Wolma befand sich das Hauptquartier des deutschen Kommandos. Es kam zu blutigen Gefechten, doch der Feind kam nicht durch.

Für ihre Kämpfe im „Minsker Kessel“ wurde der Titel „Held der Sowjetunion“ unter anderem an den Kommandeur der Maschinengewehrtruppe, Obersergeant Barij Sultanow, den Kommandeur der Gewehrtruppe, Obersergeant Fjodor Nikitin, den Kommandeur der Panzerbesatzung, Unterleutnant Nikolai Alschewski, den Kommandeur der Geschütztruppe, Sergeant Pjoter Kulakow, sowie viele andere tapfere Soldaten und Kommandeure verliehen. Hunderte wurden mit Orden und Medaillen für Mut und Tapferkeit ausgezeichnet, viele von ihnen posthum.
An den Kämpfen zur Befreiung von Stadt und Kreis Smolewitschi nahmen Einheiten der 31., 11. und 5. Garde-Panzerarmee teil. Den größten Beitrag dazu leisteten Einheiten des 2. und 3. Garde-Panzerkorps sowie der 352. Schützendivision. Die Partisanen leisteten den Truppen dabei erhebliche Unterstützung. Wie der Kommandeur des 2. Garde-Panzerkorps, Generalmajor Alexej Burdejny, berichtete, bewegte sich sein Korps in der Nacht des 2. Juli rasch durch das bewaldete und sumpfige Gelände. Erst am Vortag hatten Partisanen und Einheimische in Absprache mit dem Kommando die Landstraßen von Waldresten befreit, Brücken repariert und sumpfige Stellen befestigt. Und so ging es den ganzen Weg von Beresina bis Smolewitschy. So überwanden die Truppen die 60 Kilometer lange Strecke in wenigen Stunden und nahmen den Kampf um Smolewitschi auf.
Der Kreis wurde am 2. Juli 1944 vollständig von den Nazis befreit.

P. Kuprijanow-Straße
Pjotr Kuprijanow wurde 1926 geboren. Während des Großen Vaterländischen Krieges war er vom November 1943 bis zum 3. Juli 1944 Partisan der Abteilung „Rodina“ der Brigade „Rasgrom“. Er beteiligte sich aktiv am Eisenbahnkrieg und ließ feindliche Züge entgleisen. Mit einer Panzerabwehrkanone setzte er drei Dampflokomotiven außer Gefecht, die Züge mit Munition, Panzern und Arbeitskräften der Nazis an die Front transportierten. Seit Juli 1944 war er in der sowjetischen Armee und erreichte den Rang eines Gefreiten. Am 2. November 1944 fiel Pjotr Kuprijanow im Kampf um namenlose Höhen auf dem Gebiet Lettlands, nachdem er eine Scharte eines feindlichen Bunkers mir seiner Brust geschlossen hatte. Am 24. März 1945 wurde ihm posthum der Titel „Held der Sowjetunion” verliehen. In Wilejka, Schodino, Minsk, Polozk, Sluzk und Smolewitschi gibt es Straßen, die seinen Namen tragen.
W.Tumar- Straße
Wiktor Tumar wurde 1919 im Dorf Pelika im Kreis Smolewitschi geboren. Im Jahr 1940 wurde er in die Rote Armee einberufen. Von den ersten Kriegstagen an kämpfte er mutig an der Front. Der Schütze einer Maschinengewehrkompanie zeichnete sich bei den Kämpfen in der Nähe der rumänischen Stadt Jassy aus. Hier starteten die Nazis eine große Offensive und versuchten, unsere Verteidigung zu durchbrechen. Mit seinen Kameraden lieferte er sich einen ungleichen Kampf mit dem Feind, der versuchte, den sowjetischen Armeen in den Rücken zu fallen. Er schoss zwei Panzer und einen gepanzerten Mannschaftswagen des Feindes ab. Als die Nazis in die Kampflinie der Kompanie einbrachen, warf er sich mit einem Bündel Panzerabwehrgranaten unter den feindlichen Panzer. Er starb in diesem Gefecht. Am 13. September 1944 wurde ihm posthum der Titel „Held der Sowjetunion” verliehen. Eine der Straßen von Smolewitschi trägt seinen Namen.
P. Mascherow-Straße
Eine der Straßen im Wohngebiet Rjabyi Slup der Agrarstadt Sloboda der Gemeinde Oserzy-Sloboda ist nach der herausragenden politischen Persönlichkeit Pjotr Mascherow benannt. Er war der ehemalige Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei von Belarus. Während des Großen Vaterländischen Krieges war er einer der Organisatoren des Untergrundkampfes und der Partisanenbewegung in den Regionen Witebsk und Wilejka. Für sein Heldentum und seine Tapferkeit im Kampf gegen die Nazi-Invasoren wurde er am 15. August 1944 mit dem Titel „Held der Sowjetunion” ausgezeichnet. Auf seine Initiative und mit seiner tatkräftigen Unterstützung wurde in den 1960er Jahren auf dem Gebiet des Kreises Smolewitschi die Gedenkstätte „Hügel des Ruhmes“ errichtet, ein majestätisches Denkmal für die Befreier unserer Republik.