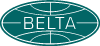Themen
"Zitadellen der Tapferkeit "
Die Stadt Slonim im westlichen Teil von Belarus wird durch die Flüsse Schtschara und Issa in mehrere Teile geteilt. Dort wurden die faschistischen Stellungen im Jahr 1941 von beiden Seiten gleichzeitig angegriffen, was selbst den deutschen Strategen Guderian verwirrte. Auf dem Gebiet operierten mehrere Partisanenbrigaden und Partisaneneinheiten und legten den Eisenbahnverkehr praktisch lahm. Im Jahr 1944 wollten die deutschen Truppen keinen Meter zurückweichen, aber sie konnten die Lawine der sowjetischen Offensive nicht aufhalten.
Guderian wäre beinahe gefangen genommen
Am Morgen des 22. Juni 1941 wurden die Flugplätze rund um Slonim bombardiert. Die Augenzeugen erinnerten sich später, sie hätten zuerst gedacht, dass dort Übungen stattfinden würden oder dass es eine Provokation wäre. Und selbst als es Tote und Verwundete und die ersten Flüchtlinge auf den Straßen gab, verstand kaum jemand, was vor sich ging. Erst nach der Radioansprache von Wjatscheslaw Molotow am Mittag wurde alles klar.
Alle Betriebe der Stadt stellten ihre Arbeit nin den Kriegsmodus um. Am Abend des 23. Juni landeten deutsche Fallschirmjäger in Slonim, und feindliche Panzerkolonnen bewegten sich unauffällig auf die Stadt zu.
„An diesem Tag wurden von unserer Seite die 155. und die 121. Schützendivisionen der Roten Armee verlegt, die den Befehl erhalten hatten, die Verteidigung zu organisieren und den Vormarsch der Nazis nach Osten zu stoppen“, erzählt ein Mitarbeiter des Heimatmuseums Slonim. „Die beiden sowjetischen Divisionen rückten auf den Feind zu. Doch schon vier Kilometer vor der Stadt stießen sie auf deutsche Motorradfahrer. Nach einem kurzen Gefecht begannen die Soldaten der Roten Armee, sich zu verschanzen.“
Am Morgen kamen Panzer der 17. Division der 2. Panzergruppe von Guderian auf unsere Stellungen zu. Die ersten Gefechte waren hart. Der Feind erlitt große Verluste, konnte aber den Ansturm nicht verringern. Am 24. Juni gelang es den Deutschen, in den westlichen Teil von Slonim vorzudringen, während der östliche Teil mit dem Bahnhof hinter dem Fluss Schtschara für sie unerreichbar war. Die 22. Panzerdivision unter dem Kommando von Oberst Iwan Kononow kam den verteidigenden Rotarmisten zu Hilfe. Ihnen gelang es, deutsche Kräfte zurückzuziehen. Hier musste der Angreifer auf die seltene Rückfrontverteidigung umstellen.
Nach Guderians Erinnerungen ertönten hinter seinem Rücken Schüsse und Explosionen, als er vom Gefechtsstand der 17. Panzerdivision im westlichen Teil von Slonim Befehle erteilte. Die Deutschen drehten sich entsetzt um - aus dem schwarzen Rauch tauchten sowjetische Panzer auf, die von hinten auf die deutschen Stellungen schossen. Obwohl die Wehrmacht sofort zum Gegenangriff überging, flogen mehrere Granaten in das Hauptquartier der 17. Panzerdivision, einer der Mitarbeiter wurde tödlich verwundet. Am selben Tag wäre Guderian beinahe gefangen genommen. Später erinnerte er sich: „Ich ging zum Gefechtsstand der Gruppe zurück und stieß plötzlich auf die russische Infanterie, die auf Lastwagen nach Slonim verlegt wurde. Mein Fahrer, der neben mir saß, erhielt den Befehl ‚Vollgas‘, und wir flogen an den staunenden Russen vorbei..."
Die heftigen Kämpfe bei Slonim ebbten nicht ab. Drei Tage lang wehrten die Einheiten der Roten Armee einen faschistischen Angriff nach dem anderen ab. Den Deutschen gelang es nur auf einem der Abschnitte durchzubrechen, wobei mehr als 50 Panzer auf der Strecke blieben. Deshalb stellte der Feind die Kampfreserve - das 46. Panzerkorps - auf. Am Abend des 26. Juni erhielten unsere Truppen den Befehl, Slonim zu verlassen.

Völkermord in der Stadt
Als die Deutschen Slonim einnahmen, lebten dort 25 Tausend Menschen, drei Viertel davon waren Juden. Die rasche Besetzung verhinderte die Evakuierung von Menschen. Der deutsche Gebietskommissar Gerhard Erren beschwerte sich bei seinen Vorgesetzten: „Es ist unmöglich, in der Stadt ein Ghetto zu errichten, da es nicht genügend Stacheldraht und Wachen gibt“. Daher verwandelten die Nazis die Siedlung tatsächlich in ein großes Konzentrationslager. Es kam zu großen Massakern, die schwersten ereigneten sich am 17. Juli und am 13. November. Bei der Razzia im Herbst wurden kleine Kinder aus den Fenstern geworfen oder vor den Augen ihrer Mütter zerrissen. Diejenigen, die zur Erschießung gebracht wurden, wurden gezwungen, sich auszuziehen und „Katjuscha“ zu singen. Das letzte Massaker an Juden verübten die Deutschen im Dezember 1942....
„Trotz der tödlichen Gefahr hat der Untergrund im Ghetto von Slonim ein Zentrum eingerichtet, das etwa hundert Menschen zählte“, erzählt uns ein Mitarbeiter des Heimatmuseums. „Wer im Lager arbeitete, wo Kriegstrophäen gesammelt wurden, konnte an Waffen und Munition herankommen und übergab sie heimlich an die Partisanen.“
Deutsche, lettische Polizisten und belarussische Kollaborateure verübten auch grausame Massaker an den Bewohnern der Region Slonim. Im „Protokoll über deutsche Gräueltaten im Kreis Slonim“ vom 19. Juli 1944 ist angeführt, dass in der Nacht zum 4. Juli auf dem Berg Petralewitschi einen Kilometer von der Stadt entfernt mehrere Zivilisten ermordet wurden. Sowjetische Ermittler haben die Leichen von Eltern mit ihren Kindern aus einem Massengrab geborgen. Unter den Ermordeten befanden sich Ärzte, Ingenieure, Priesterseminarschüler und Bauern. „Allen Opfern wurden die Hände mit Draht auf dem Rücken gefesselt... die Kinder wurden lebendig in die Grube geworfen...“ - bezeugt das Dokument. Das Massaker fand eine Woche vor der Befreiung der Siedlung von den Nazis statt.

Partisanengebiet
Mitglieder der Partei und Komsomolzen, eingekesselte Soldaten und Offiziere der Roten Armee flüchteten in die Wälder des besetzten Gebietes. Sie sammelten Waffen, schlossen sich in Gruppen zusammen und verübten Sabotageakte. So entstand im Juli 1941 die erste Partisanengruppe in den naheliegenden Wäldern. Angeführt wurde sie von dem ehemaligen Leiter der Kolchose Alexander Fidrik. Im Spätherbst wurden die Volksrächer nach einem Verrat von den Nazis umzingelt. In einem ungleichen Kampf wurden Fidrik und mehrere andere Kämpfer getötet.
„Die am Leben gebliebenen Partisanen schlossen sich der Gruppe von Pawel Pronjagin an, der im April 1942 die Partisaneneinheit Schtschors gründete. Sie wuchs sehr schnell um neue Kämpfer. Ihr schlossen sich ehemalige Kriegsgefangene, Ghettoinsassen und Einheimische an. Ende Juli zählte die Einheit mehr als 500 Mann, die nicht nur mit Handfeuerwaffen, sondern auch mit Dutzenden von Maschinengewehren und zwei 45-mm-Kanonen bewaffnet waren.“
Im August 1942 besiegte die Schtschors-Einheit mit Hilfe anderer Partisanengruppen die deutsche Garnison in Kossowo, die aus mehr als 300 Nazis und Kollaborateuren bestand. Dutzende von Nazis wurden getötet, Lagerhäuser mit Waffen wurden besetzt, etwa 200 Ghetto-Gefangene wurden freigelassen. Eine Woche später zerstörten die Schtschors-Männer die deutsche Maschinengewehrschule im Dorf Gawenowitschi.
Andere Partisaneneinheiten, darunter die Brigaden „Sowetskaja Belorussija“, Rokossowski-Brigade, Ponomarenko-Brigade operierten ebenfalls in der Region Slonim. Die Kämpfer zerstörten 10 deutsche Garnisonen, ließen Dutzende von Zügen entgleisen und legten den Verkehr auf den Eisenbahnstrecken Slonim - Baranowitschi und Baranowitschi - Lida fast vollständig lahm.
„Im Oktober 1943 wurde im Slonimer Untergrund das Bezirkskomitee der Kommunistischen Partei Weißrusslands gegründet“, heißt es. „Den einheimischen Untergrundkämpfern gelang es sogar, ihren Mann zum Leiter des belarussischen Zentralrats Radoslaw Ostrowski zu schicken. Seine persönliche Sekretärin war Jewdokija Koslowa, die den Verräter vor der Besatzung kannte und während des Krieges in Slonim war. Der Frau gelang es, Ostrowskis Vertrauen zu gewinnen, wodurch die Rächer des Volkes wertvolle nachrichtendienstliche Informationen erhielten.
Die Freude über die Befreiung
Im Juli 1944 zogen sich die bei Baranowitschi geschlagenen deutschen Einheiten nach Slonim zurück. Trotz des Artillerie- und Mörserfeuers des Gegners und der Luftwaffenangriffe folgten die vorderen Einheiten der Roten Armee den sich zurückziehenden Angreifern. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Deutschen den Vormarsch der Einheiten der Roten Armee nicht mehr aufhalten.
Die sowjetischen Truppen begannen den Angriff auf Slonim am 9. Juli 1944 um fünf Uhr abends. Die Einheiten der 1. Weißrussischen Front stießen von drei Seiten gleichzeitig auf die Stadt vor. Bis zehn Uhr abends entbrannten in Slonim heftige Straßenkämpfe. Einige Stunden später flohen die Deutschen in den westlichen Teil der Stadt und sprengten die Brücken über die Schtschara. Um Mitternacht begannen die Kämpfer der Roten Armee, die den Feind verfolgten, unter ständigem Artillerie- und Maschinengewehrfeuer den Fluss zu überqueren.

„Bis 10 Uhr morgens durchbrachen Teile der 37. Garde-Schützen-Division die feindliche Verteidigung im nördlichen Teil der Stadt. Fast zeitgleich ergriffen Kämpfer der 15. Infanteriedivision die Initiative im südlichen Teil der Siedlung. Die überlebenden Faschisten rannten chaotisch nach Westen. Bis zum Mittag des 10. Juli 1944 war Slonim von den Resten der deutschen Armee befreit. Die Faschisten haben sich in Kellern und auf Dachböden verschanzt“, erzählt der Mitarbeiter des Heimatmuseums Slonim.
Doch die deutsche Führung konnte den Verlust einer strategisch wichtigen Siedlung nicht so einfach hinnehmen. Infanteriebataillone der Wehrmacht, unterstützt von Panzergruppen, gingen zum Gegenangriff über. Sie wurden allesamt zurückgeschlagen.
Die unvollendete Geschichte von Wasja Kraini
Der 1929 geborene Wasja Kraini schloss sich wie sein älterer Bruder Anton den Partisanen an. Er kämpfte als zweite Nummer einer Maschinengewehrmannschaft und nahm an Kampfhandlungen teil. Im Januar 1944 half er seinen älteren Kameraden, einen deutschen Militärzug zu sprengen. Auf dem Rückweg zum Stützpunkt gerieten die Volksrächer in einen Hinterhalt und wurden vernichtet. Als letztes verstummte das Maschinengewehr. Nachdem er mehr als sechs Schusswunden erlitten hatte, verlor Wasja das Bewusstsein und wurde gefangen genommen. Die Nazis wollten von ihm erfahren, wo sich das Kommando befand. Nach Angaben der Ärztin Jekaterina Schurawljowa weigerte sich der Jung im Krankenhaus, Medikamente zu nehmen, riss sich die Verbände ab und rieb sich die Wunden mit Erde ein.
Das weitere Schicksal von Kraini ist unbekannt, nur eines steht fest: die Gestapo hat keine Informationen von ihm erhalten. Die einzige Zeugin, die Ärztin Schurawljowa, wurde zusammen mit zwei Töchtern im Alter von 5 und 7 Jahren von den Deutschen hingerichtet. Kein einziges Foto des Helden ist erhalten geblieben. Im Jahr 1965 wurde Wassili Antonowitsch Kraini posthum mit der Medaille „Für Tapferkeit“ ausgezeichnet. Eine der Straßen von Slonim trägt seinen Namen.
Im Jahr 1942, während des Kampfes gegen die deutsche Garnison im Dorf Tribuschki (Mirnaja), schloss der Partisan Kasjan Panasewitsch mit seinem Körper die Schießscharte des Bunkers und ermöglichte seinen Kameraden den Vormarsch.
Die 11 Formationen und Einheiten der 1. Weißrussischen Front, die sich bei der Befreiung der Stadt und der Erstürmung des Flusses Schtschara ausgezeichnet haben, erhielten den Ehrennamen „Slonimski“. Zu Ehren der Befreiung der Stadt wurde im Juli 1944 in Moskau ein Salut mit 20 Artilleriesalven aus 224 Geschützen gegeben.
Gerhard Erren, der Gebietskommissar von Slonim von 1941 bis 1944, wurde nie bestraft. Zeitzeugen erinnerten sich, dass er in den Jahren der Besatzung mit einem Hund und einer Peitsche durch die Stadt lief und sich damit vergnügte, Passanten zu verprügeln. Nach dem Krieg arbeitete der Henker als Lehrer in Deutschland. Erst 1974 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er jedoch aufgrund bürokratischer Verzögerungen nie antrat. Er starb friedlich im Jahr 1984.
Lange Zeit glaubte man, dass die Nazis während des Krieges in Slonim 44.418 Menschen getötet haben. Jetzt wird diese Zahl präzisiert.
Straßen tragen ihre Namen
Pronjagin Straße
Pawel Wassiljewitsch Pronjagin wurde 1916 geboren. Zunächst arbeitete er als Mathematiklehrer, später machte er Karriere beim Militär. Er war Hauptmann. Sein erstes Gefecht bestritt er am 26. Juni 1941. Nachdem er eine Verwundung erlitten hatte, wurde er umzingelt. Er ging zu den Partisanen, im Frühjahr 1942 leitete er die Schtschors-Einheit. Pronjagins Kämpfer waren in den Regionen Baranowitschi, Brest, Minsk und Pinsk im Einsatz.

Pronjagin war einer der Organisatoren der Niederlage der deutschen Garnison in Kossowo und anderer erfolgreicher Partisanenaktionen. Im Frühjahr 1943 wurde der Brester Partisanenverband gegründet, der im Sommer 1944 über 11 Brigaden und 12 Einheiten verfügte. Nach dem Krieg war er Schuldirektor zunächst in der Tatarischen ASSR, später in Welikie Luki im Kreis Baranowitschi. Nach seiner Pensionierung lebte er in Brest. Im Jahr 1979 wurde ein Buch mit seinen Memoiren „An der Grenze“ veröffentlicht. Er war persönlicher Pensionär von nationaler Bedeutung, Ehrenbürger von Brest (1974). Er starb 1997. Straßen in Brest und Kossowo tragen seinen Namen.
Sinitschkin Straße
Fjodor Michailowitsch Sinitschkin wurde 1901 geboren. Er kämpfte an den Fronten des Bürgerkriegs. Militäroffizier, Hauptmann. Seit 1940 kommandierte er ein eigenes Automobilbataillon im belarussischen Militärbezirk. In den ersten Tagen des Krieges wurde Sinitschkin verwundet. Seine Einheit durchbrach die Umzingelung und fand sich in Nalibokskaja Puschtscha wieder. Dort gründete der Offizier im August 1941 die erste Partisanengruppe. Ende 1942 schloss er die versprengten Partisaneneinheiten in Lipitschanskaja Puschtscha zur Lenin-Brigade zusammen. Sie war mit einem Panzer, einem Panzerwagen, Kanonen und Maschinengewehren bewaffnet. Fjodor Michailowitsch hielt alles in Ordnung, organisierte die Ausbildung in Subversion. Bereits im Mai 1943 umfasste die Lenin-Brigade 6 Einheiten mit einer Gesamtzahl von mehr als zweitausend Kämpfern. Später gründete Sinitschkin die Kirow-Brigade, die allein im Herbst 1943 26 Militärzüge entgleisen ließ und 20 Brücken sprengte. Am 15. August 1944 wurde der Partisanenkommandant mit dem Titel „Held der Sowjetunion“ ausgezeichnet. Nach dem Krieg bekleidete Fjodor Sinitschkin lange Zeit verschiedene Führungspositionen in Slonim und setzte sich sehr für den Wiederaufbau der Stadt ein (Vorsitzender des Stadtrates - von April 1946 bis Oktober 1947). Er starb im Jahr 1962. Eine der Straßen des Stadtteilzentrums trägt seinen Namen.

Miroschnik Straße
Nikolai Wladimirowitsch Miroschnik wurde 1925 in der Nähe von Charkow geboren. Während der Besetzung seiner Heimatstadt durch die Nazis sah er mit eigenen Augen alle Schrecken des Naziregimes: Massenhinrichtungen, Terror gegen die Zivilbevölkerung. Nach der Befreiung von Charkow wurde er in die Rote Armee eingezogen. Er kämpfte an der Leningrader und der 1. Weißrussischen Front. Er war Schütze des 118. Garde-Schützenregiments der 37. Garde-Schützen-Division. Während der Befreiung von Belarus rückte die Armeeeinheit, in deren Reihen Miroschnik kämpfte, in Richtung Ossipowitschi - Baranowitschi - Slonim vor. Bei der Überwindung des Flusses Schtschara in der Nähe von Slonim schloss er mit seinem Körper die Scharte des deutschen Maschinengewehrs, was das Leben seiner Kameraden rettete und ihr Weiterkommen während des Angriffs sicherte. Zum Zeitpunkt seines Todes war Nikolai Miroschnik 19 Jahre alt. Der Held ist in einem Massengrab in Slonim begraben. Am 15. Februar 1968 wurde ihm (posthum) der Orden des Vaterländischen Krieges ersten Grades verliehen. Eine Straße und eine Gasse in Slonim tragen den Namen von Nikolai Miroschnik.

Alexej Gorbunow
Fotos: BELTA, Heimatmuseum Slonim,
„7 Tage“
Guderian wäre beinahe gefangen genommen
Am Morgen des 22. Juni 1941 wurden die Flugplätze rund um Slonim bombardiert. Die Augenzeugen erinnerten sich später, sie hätten zuerst gedacht, dass dort Übungen stattfinden würden oder dass es eine Provokation wäre. Und selbst als es Tote und Verwundete und die ersten Flüchtlinge auf den Straßen gab, verstand kaum jemand, was vor sich ging. Erst nach der Radioansprache von Wjatscheslaw Molotow am Mittag wurde alles klar.
Alle Betriebe der Stadt stellten ihre Arbeit nin den Kriegsmodus um. Am Abend des 23. Juni landeten deutsche Fallschirmjäger in Slonim, und feindliche Panzerkolonnen bewegten sich unauffällig auf die Stadt zu.
„An diesem Tag wurden von unserer Seite die 155. und die 121. Schützendivisionen der Roten Armee verlegt, die den Befehl erhalten hatten, die Verteidigung zu organisieren und den Vormarsch der Nazis nach Osten zu stoppen“, erzählt ein Mitarbeiter des Heimatmuseums Slonim. „Die beiden sowjetischen Divisionen rückten auf den Feind zu. Doch schon vier Kilometer vor der Stadt stießen sie auf deutsche Motorradfahrer. Nach einem kurzen Gefecht begannen die Soldaten der Roten Armee, sich zu verschanzen.“
Am Morgen kamen Panzer der 17. Division der 2. Panzergruppe von Guderian auf unsere Stellungen zu. Die ersten Gefechte waren hart. Der Feind erlitt große Verluste, konnte aber den Ansturm nicht verringern. Am 24. Juni gelang es den Deutschen, in den westlichen Teil von Slonim vorzudringen, während der östliche Teil mit dem Bahnhof hinter dem Fluss Schtschara für sie unerreichbar war. Die 22. Panzerdivision unter dem Kommando von Oberst Iwan Kononow kam den verteidigenden Rotarmisten zu Hilfe. Ihnen gelang es, deutsche Kräfte zurückzuziehen. Hier musste der Angreifer auf die seltene Rückfrontverteidigung umstellen.
Nach Guderians Erinnerungen ertönten hinter seinem Rücken Schüsse und Explosionen, als er vom Gefechtsstand der 17. Panzerdivision im westlichen Teil von Slonim Befehle erteilte. Die Deutschen drehten sich entsetzt um - aus dem schwarzen Rauch tauchten sowjetische Panzer auf, die von hinten auf die deutschen Stellungen schossen. Obwohl die Wehrmacht sofort zum Gegenangriff überging, flogen mehrere Granaten in das Hauptquartier der 17. Panzerdivision, einer der Mitarbeiter wurde tödlich verwundet. Am selben Tag wäre Guderian beinahe gefangen genommen. Später erinnerte er sich: „Ich ging zum Gefechtsstand der Gruppe zurück und stieß plötzlich auf die russische Infanterie, die auf Lastwagen nach Slonim verlegt wurde. Mein Fahrer, der neben mir saß, erhielt den Befehl ‚Vollgas‘, und wir flogen an den staunenden Russen vorbei..."
Die heftigen Kämpfe bei Slonim ebbten nicht ab. Drei Tage lang wehrten die Einheiten der Roten Armee einen faschistischen Angriff nach dem anderen ab. Den Deutschen gelang es nur auf einem der Abschnitte durchzubrechen, wobei mehr als 50 Panzer auf der Strecke blieben. Deshalb stellte der Feind die Kampfreserve - das 46. Panzerkorps - auf. Am Abend des 26. Juni erhielten unsere Truppen den Befehl, Slonim zu verlassen.

Völkermord in der Stadt
Als die Deutschen Slonim einnahmen, lebten dort 25 Tausend Menschen, drei Viertel davon waren Juden. Die rasche Besetzung verhinderte die Evakuierung von Menschen. Der deutsche Gebietskommissar Gerhard Erren beschwerte sich bei seinen Vorgesetzten: „Es ist unmöglich, in der Stadt ein Ghetto zu errichten, da es nicht genügend Stacheldraht und Wachen gibt“. Daher verwandelten die Nazis die Siedlung tatsächlich in ein großes Konzentrationslager. Es kam zu großen Massakern, die schwersten ereigneten sich am 17. Juli und am 13. November. Bei der Razzia im Herbst wurden kleine Kinder aus den Fenstern geworfen oder vor den Augen ihrer Mütter zerrissen. Diejenigen, die zur Erschießung gebracht wurden, wurden gezwungen, sich auszuziehen und „Katjuscha“ zu singen. Das letzte Massaker an Juden verübten die Deutschen im Dezember 1942....
„Trotz der tödlichen Gefahr hat der Untergrund im Ghetto von Slonim ein Zentrum eingerichtet, das etwa hundert Menschen zählte“, erzählt uns ein Mitarbeiter des Heimatmuseums. „Wer im Lager arbeitete, wo Kriegstrophäen gesammelt wurden, konnte an Waffen und Munition herankommen und übergab sie heimlich an die Partisanen.“
Deutsche, lettische Polizisten und belarussische Kollaborateure verübten auch grausame Massaker an den Bewohnern der Region Slonim. Im „Protokoll über deutsche Gräueltaten im Kreis Slonim“ vom 19. Juli 1944 ist angeführt, dass in der Nacht zum 4. Juli auf dem Berg Petralewitschi einen Kilometer von der Stadt entfernt mehrere Zivilisten ermordet wurden. Sowjetische Ermittler haben die Leichen von Eltern mit ihren Kindern aus einem Massengrab geborgen. Unter den Ermordeten befanden sich Ärzte, Ingenieure, Priesterseminarschüler und Bauern. „Allen Opfern wurden die Hände mit Draht auf dem Rücken gefesselt... die Kinder wurden lebendig in die Grube geworfen...“ - bezeugt das Dokument. Das Massaker fand eine Woche vor der Befreiung der Siedlung von den Nazis statt.

Partisanengebiet
Mitglieder der Partei und Komsomolzen, eingekesselte Soldaten und Offiziere der Roten Armee flüchteten in die Wälder des besetzten Gebietes. Sie sammelten Waffen, schlossen sich in Gruppen zusammen und verübten Sabotageakte. So entstand im Juli 1941 die erste Partisanengruppe in den naheliegenden Wäldern. Angeführt wurde sie von dem ehemaligen Leiter der Kolchose Alexander Fidrik. Im Spätherbst wurden die Volksrächer nach einem Verrat von den Nazis umzingelt. In einem ungleichen Kampf wurden Fidrik und mehrere andere Kämpfer getötet.
„Die am Leben gebliebenen Partisanen schlossen sich der Gruppe von Pawel Pronjagin an, der im April 1942 die Partisaneneinheit Schtschors gründete. Sie wuchs sehr schnell um neue Kämpfer. Ihr schlossen sich ehemalige Kriegsgefangene, Ghettoinsassen und Einheimische an. Ende Juli zählte die Einheit mehr als 500 Mann, die nicht nur mit Handfeuerwaffen, sondern auch mit Dutzenden von Maschinengewehren und zwei 45-mm-Kanonen bewaffnet waren.“
Im August 1942 besiegte die Schtschors-Einheit mit Hilfe anderer Partisanengruppen die deutsche Garnison in Kossowo, die aus mehr als 300 Nazis und Kollaborateuren bestand. Dutzende von Nazis wurden getötet, Lagerhäuser mit Waffen wurden besetzt, etwa 200 Ghetto-Gefangene wurden freigelassen. Eine Woche später zerstörten die Schtschors-Männer die deutsche Maschinengewehrschule im Dorf Gawenowitschi.
Andere Partisaneneinheiten, darunter die Brigaden „Sowetskaja Belorussija“, Rokossowski-Brigade, Ponomarenko-Brigade operierten ebenfalls in der Region Slonim. Die Kämpfer zerstörten 10 deutsche Garnisonen, ließen Dutzende von Zügen entgleisen und legten den Verkehr auf den Eisenbahnstrecken Slonim - Baranowitschi und Baranowitschi - Lida fast vollständig lahm.
„Im Oktober 1943 wurde im Slonimer Untergrund das Bezirkskomitee der Kommunistischen Partei Weißrusslands gegründet“, heißt es. „Den einheimischen Untergrundkämpfern gelang es sogar, ihren Mann zum Leiter des belarussischen Zentralrats Radoslaw Ostrowski zu schicken. Seine persönliche Sekretärin war Jewdokija Koslowa, die den Verräter vor der Besatzung kannte und während des Krieges in Slonim war. Der Frau gelang es, Ostrowskis Vertrauen zu gewinnen, wodurch die Rächer des Volkes wertvolle nachrichtendienstliche Informationen erhielten.
Die Freude über die Befreiung
Im Juli 1944 zogen sich die bei Baranowitschi geschlagenen deutschen Einheiten nach Slonim zurück. Trotz des Artillerie- und Mörserfeuers des Gegners und der Luftwaffenangriffe folgten die vorderen Einheiten der Roten Armee den sich zurückziehenden Angreifern. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Deutschen den Vormarsch der Einheiten der Roten Armee nicht mehr aufhalten.
Die sowjetischen Truppen begannen den Angriff auf Slonim am 9. Juli 1944 um fünf Uhr abends. Die Einheiten der 1. Weißrussischen Front stießen von drei Seiten gleichzeitig auf die Stadt vor. Bis zehn Uhr abends entbrannten in Slonim heftige Straßenkämpfe. Einige Stunden später flohen die Deutschen in den westlichen Teil der Stadt und sprengten die Brücken über die Schtschara. Um Mitternacht begannen die Kämpfer der Roten Armee, die den Feind verfolgten, unter ständigem Artillerie- und Maschinengewehrfeuer den Fluss zu überqueren.

„Bis 10 Uhr morgens durchbrachen Teile der 37. Garde-Schützen-Division die feindliche Verteidigung im nördlichen Teil der Stadt. Fast zeitgleich ergriffen Kämpfer der 15. Infanteriedivision die Initiative im südlichen Teil der Siedlung. Die überlebenden Faschisten rannten chaotisch nach Westen. Bis zum Mittag des 10. Juli 1944 war Slonim von den Resten der deutschen Armee befreit. Die Faschisten haben sich in Kellern und auf Dachböden verschanzt“, erzählt der Mitarbeiter des Heimatmuseums Slonim.
Doch die deutsche Führung konnte den Verlust einer strategisch wichtigen Siedlung nicht so einfach hinnehmen. Infanteriebataillone der Wehrmacht, unterstützt von Panzergruppen, gingen zum Gegenangriff über. Sie wurden allesamt zurückgeschlagen.
Die unvollendete Geschichte von Wasja Kraini
Der 1929 geborene Wasja Kraini schloss sich wie sein älterer Bruder Anton den Partisanen an. Er kämpfte als zweite Nummer einer Maschinengewehrmannschaft und nahm an Kampfhandlungen teil. Im Januar 1944 half er seinen älteren Kameraden, einen deutschen Militärzug zu sprengen. Auf dem Rückweg zum Stützpunkt gerieten die Volksrächer in einen Hinterhalt und wurden vernichtet. Als letztes verstummte das Maschinengewehr. Nachdem er mehr als sechs Schusswunden erlitten hatte, verlor Wasja das Bewusstsein und wurde gefangen genommen. Die Nazis wollten von ihm erfahren, wo sich das Kommando befand. Nach Angaben der Ärztin Jekaterina Schurawljowa weigerte sich der Jung im Krankenhaus, Medikamente zu nehmen, riss sich die Verbände ab und rieb sich die Wunden mit Erde ein.
Das weitere Schicksal von Kraini ist unbekannt, nur eines steht fest: die Gestapo hat keine Informationen von ihm erhalten. Die einzige Zeugin, die Ärztin Schurawljowa, wurde zusammen mit zwei Töchtern im Alter von 5 und 7 Jahren von den Deutschen hingerichtet. Kein einziges Foto des Helden ist erhalten geblieben. Im Jahr 1965 wurde Wassili Antonowitsch Kraini posthum mit der Medaille „Für Tapferkeit“ ausgezeichnet. Eine der Straßen von Slonim trägt seinen Namen.
Im Jahr 1942, während des Kampfes gegen die deutsche Garnison im Dorf Tribuschki (Mirnaja), schloss der Partisan Kasjan Panasewitsch mit seinem Körper die Schießscharte des Bunkers und ermöglichte seinen Kameraden den Vormarsch.
Die 11 Formationen und Einheiten der 1. Weißrussischen Front, die sich bei der Befreiung der Stadt und der Erstürmung des Flusses Schtschara ausgezeichnet haben, erhielten den Ehrennamen „Slonimski“. Zu Ehren der Befreiung der Stadt wurde im Juli 1944 in Moskau ein Salut mit 20 Artilleriesalven aus 224 Geschützen gegeben.
Gerhard Erren, der Gebietskommissar von Slonim von 1941 bis 1944, wurde nie bestraft. Zeitzeugen erinnerten sich, dass er in den Jahren der Besatzung mit einem Hund und einer Peitsche durch die Stadt lief und sich damit vergnügte, Passanten zu verprügeln. Nach dem Krieg arbeitete der Henker als Lehrer in Deutschland. Erst 1974 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er jedoch aufgrund bürokratischer Verzögerungen nie antrat. Er starb friedlich im Jahr 1984.
Lange Zeit glaubte man, dass die Nazis während des Krieges in Slonim 44.418 Menschen getötet haben. Jetzt wird diese Zahl präzisiert.
Straßen tragen ihre Namen
Pronjagin Straße
Pawel Wassiljewitsch Pronjagin wurde 1916 geboren. Zunächst arbeitete er als Mathematiklehrer, später machte er Karriere beim Militär. Er war Hauptmann. Sein erstes Gefecht bestritt er am 26. Juni 1941. Nachdem er eine Verwundung erlitten hatte, wurde er umzingelt. Er ging zu den Partisanen, im Frühjahr 1942 leitete er die Schtschors-Einheit. Pronjagins Kämpfer waren in den Regionen Baranowitschi, Brest, Minsk und Pinsk im Einsatz.

Pronjagin war einer der Organisatoren der Niederlage der deutschen Garnison in Kossowo und anderer erfolgreicher Partisanenaktionen. Im Frühjahr 1943 wurde der Brester Partisanenverband gegründet, der im Sommer 1944 über 11 Brigaden und 12 Einheiten verfügte. Nach dem Krieg war er Schuldirektor zunächst in der Tatarischen ASSR, später in Welikie Luki im Kreis Baranowitschi. Nach seiner Pensionierung lebte er in Brest. Im Jahr 1979 wurde ein Buch mit seinen Memoiren „An der Grenze“ veröffentlicht. Er war persönlicher Pensionär von nationaler Bedeutung, Ehrenbürger von Brest (1974). Er starb 1997. Straßen in Brest und Kossowo tragen seinen Namen.
Sinitschkin Straße
Fjodor Michailowitsch Sinitschkin wurde 1901 geboren. Er kämpfte an den Fronten des Bürgerkriegs. Militäroffizier, Hauptmann. Seit 1940 kommandierte er ein eigenes Automobilbataillon im belarussischen Militärbezirk. In den ersten Tagen des Krieges wurde Sinitschkin verwundet. Seine Einheit durchbrach die Umzingelung und fand sich in Nalibokskaja Puschtscha wieder. Dort gründete der Offizier im August 1941 die erste Partisanengruppe. Ende 1942 schloss er die versprengten Partisaneneinheiten in Lipitschanskaja Puschtscha zur Lenin-Brigade zusammen. Sie war mit einem Panzer, einem Panzerwagen, Kanonen und Maschinengewehren bewaffnet. Fjodor Michailowitsch hielt alles in Ordnung, organisierte die Ausbildung in Subversion. Bereits im Mai 1943 umfasste die Lenin-Brigade 6 Einheiten mit einer Gesamtzahl von mehr als zweitausend Kämpfern. Später gründete Sinitschkin die Kirow-Brigade, die allein im Herbst 1943 26 Militärzüge entgleisen ließ und 20 Brücken sprengte. Am 15. August 1944 wurde der Partisanenkommandant mit dem Titel „Held der Sowjetunion“ ausgezeichnet. Nach dem Krieg bekleidete Fjodor Sinitschkin lange Zeit verschiedene Führungspositionen in Slonim und setzte sich sehr für den Wiederaufbau der Stadt ein (Vorsitzender des Stadtrates - von April 1946 bis Oktober 1947). Er starb im Jahr 1962. Eine der Straßen des Stadtteilzentrums trägt seinen Namen.

Miroschnik Straße
Nikolai Wladimirowitsch Miroschnik wurde 1925 in der Nähe von Charkow geboren. Während der Besetzung seiner Heimatstadt durch die Nazis sah er mit eigenen Augen alle Schrecken des Naziregimes: Massenhinrichtungen, Terror gegen die Zivilbevölkerung. Nach der Befreiung von Charkow wurde er in die Rote Armee eingezogen. Er kämpfte an der Leningrader und der 1. Weißrussischen Front. Er war Schütze des 118. Garde-Schützenregiments der 37. Garde-Schützen-Division. Während der Befreiung von Belarus rückte die Armeeeinheit, in deren Reihen Miroschnik kämpfte, in Richtung Ossipowitschi - Baranowitschi - Slonim vor. Bei der Überwindung des Flusses Schtschara in der Nähe von Slonim schloss er mit seinem Körper die Scharte des deutschen Maschinengewehrs, was das Leben seiner Kameraden rettete und ihr Weiterkommen während des Angriffs sicherte. Zum Zeitpunkt seines Todes war Nikolai Miroschnik 19 Jahre alt. Der Held ist in einem Massengrab in Slonim begraben. Am 15. Februar 1968 wurde ihm (posthum) der Orden des Vaterländischen Krieges ersten Grades verliehen. Eine Straße und eine Gasse in Slonim tragen den Namen von Nikolai Miroschnik.

Alexej Gorbunow
Fotos: BELTA, Heimatmuseum Slonim,
„7 Tage“