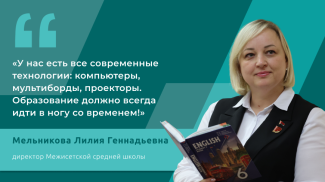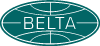Themen
"Zitadellen der Tapferkeit "
Während des Großen Vaterländischen Krieges kämpften die Einwohner hunderter belarussischer Städte und Dörfer gegen den Feind und brachten den Sieg näher. Sechsunddreißig Ortschaften wurden besonders ausgezeichnet und später mit Wimpeln „Für Mut und Tapferkeit im Großen Vaterländischen Krieg“ geehrt. Dieses Abzeichen wurde am 6. Oktober 2004 per Präsidialdekret anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung der Republik von den Nazis eingeführt. Hinter jeder der 36 Zitadellen der Tapferkeit verbirgt sich eine erstaunliche Geschichte von Mut, Heldentum und dem Glauben an den Sieg für alle. Wir werden darüber in unserem neuen Projekt zum 80. Jahrestag der Befreiung von Belarus von den Nazis berichten. Heute berichten wir über die Stadt Klitschew.
Während des Großen Vaterländischen Krieges entwickelte sich der Kreis Klitschew zu einem der größten Partisanengebiete auf dem Gebiet der BSSR. Der Kampf gegen den Feind hatte hier einen wahrhaft nationalen Charakter: Vertreter von 67 Nationalitäten kämpften in Partisanenverbänden. Ende März 1942, als das Land fast komplett von den Nazis besetzt war, gelang den Partisanen von Klitschew das Unmögliche: Sie besiegten die letzte deutsche Polizeigarnison auf im Kreis und stellten am 3. April die Sowjetmacht wieder her.
Ganzer Sowjetkreis hinter den feindlichen Linien
Der Kreis Klitschew wurde am 5. Juli 1941 besetzt, und bereits am 14. Juli nahm die erste Partisaneneinheit ihre Arbeit auf. Sie bestand aus 30 Personen und trug den Namen „Klitschewski“.
„Die Volksrächer hatten keine Zeit für lange Vorbereitungs- und Aufklärungsarbeit, sie mussten so schnell wie möglich handeln. Daher wurde der Tag der Bildung der Abteilung gleichzeitig der Tag ihrer ersten Schlacht: Die Partisanen zerstörten zwei Autos auf der Straße Mogiljow - Tschetschewitschi und erbeuteten Trophäen. Dann überfiel die Einheit den Flugplatz von Klitschew und verbrannte 45 Tonnen Benzin“, erzählt die Direktorin des Klitschewer Heimatmuseums Julia Lyso.

Die Monate vergingen, und die Zahl der Partisanen in der Region nahm zu. Mit der Zeit schlossen sich die Einheiten zusammen und räumten gemeinsam das Gebiet von den Besatzern. Am 20. März 1942 wurde die letzte deutsche Polizeigarnison vernichtet. Der gesamte Kreis geriet unter die Kontrolle der Volksrächer. Und am 3. April wurde hier die Sowjetmacht wiederhergestellt: Das Kreisparteikomitee, das Kreisexekutivkomitee und alle Dorfräte nahmen ihre Arbeit wieder auf. Diese Ereignisse leiteten die Bildung einer neuen Partisanenzone ein.
„Die Nachricht, dass ein ganzer Sowjetkreis hinter den feindlichen Linien aufgetaucht war, verbreitete sich blitzschnell. Nicht nur aus den benachbarten Kreisen, sondern auch aus anderen Regionen des Landes strömten die Menschen auf der Flucht vor Erschießungen und Völkermord in den Kreis Klitschew. Ganze Familien zogen um. Wer Waffen halten konnte, ging zu den Partisanen, der Rest wurde in Dörfern untergebracht. Später, als die Sommerblockade begann, wurden in den Wäldern Familienlagern gebildet“, erzählt die Museumsdirektorin. „Groben Schätzungen zufolge lebten in der Partisanenzone mehr als 70 Tausend Menschen, während es im gesamten Kreis vor dem Krieg etwas mehr als 46 Tausend waren.
Der Wald von Usakino wurde zu einem zuverlässigen Unterschlupf für die Volksrächer. Dort befanden sich nicht nur Partisanenstützpunkte, Hauptquartiere und Krankenhäuser, sondern sogar Landeplätze für Flugzeuge. Der Kampf gegen die Faschisten war eine Angelegenheit, die alle betraf. Daran beteiligten sich sogar Frauen und Kinder. Vertreter von 67 Nationalitäten kämpften in Partisanenverbänden:
„Der legendäre Georgier Iskander Alasow, ein junger Adjutanten des Kommandanten der 278. Sondereinheit, hat einen schwer verwundeten Zugführer vom Schlachtfeld im Dorf Soltanowka gerettet – darüber wurde überall erzählt. Und in der 15. Partisaneneinheit wurden die wichtigsten Aufgaben der Kompanie unter dem Kommando des Kalmücken Michail Choninow alias Mischa Tschorny übertragen. Die Faschisten setzten auf ihn ein Kopfgeld in Höhe von 10.000 Reichsmark, aber es gelang ihnen nie, ihn zu fassen. Der Franzose Jean-Marie kämpfte ebenfalls auf der Seite der Partisanen. Ein Hauptmann des Sanitätsdienstes der deutschen Armee ist freiwillig auf die Seite der Volksrächer übergelaufen.
Die Partisanenzone wurde Ende 1943 vollständig gebildet. Sie erstreckte sich über etwa 3.000 Quadratkilometer und umfasste nicht nur das Territorium des Kreises Klitschew, sondern teilweise auch die angrenzenden Kreise Beresina, Belynitschi, Bychow, Kirow und Bobruisk. Die Partisanen hielten Kontakt mit dem Hinterland. Waffen, Munition, Medikamente und Zeitungen wurden per Luft geliefert, sie schickten eigene Sabotage- und Aufklärungsgruppen. Zurück ins Hinterland wurden Verwundete und Kranke, Alte und Kinder evakuiert.

Die Zone war das Zentrum der Partisanenbewegung in der gesamten Region Mogiljow. Alle leitenden Organe hatten hier ihren Sitz: das regionale Untergrundkomitee der Partei und das regionale Komsomol-Komitee von Mogiljow, der Stab der militärisch-operativen Gruppe Mogiljow, Untergrundkomitees der Partei und des Komsomol in den Städten Bobruisk, Belynitschi, Beresina, Mogiljow und Klitschew.
Die Menschen mussten fünf faschistische Blockaden überstehen
Die Partisanen stellten eine große Bedrohung für die deutschen Truppen im rückwärtigen Operationsgebiet dar. Der Feind konnte den Verlust der Kontrolle über das gesamte Gebiet nicht hinnehmen. Deshalb ordnete das deutsche Kommando ab Mai 1942 mehrere Strafoperationen gegen die Partisanen an.
„Selbst eine solche Blockade ist schwer zu überleben. Und der Kreis hat fünf Blockaden überstanden. Sie alle hatten poetische Namen, brachten den Menschen aber nur Leid und Tod“, sagt die Museumsleiterin.
Den Deutschen gelang es nicht, die Partisanenverbände während der Blockaden zu vernichten, aber sie durchkämmten methodisch den Wald von Usakino, zerschlugen leere Partisanenlager und massakrierten brutal die Zivilbevölkerung. Das Sowinformbüro meldete am 13. August 1942, dass im Operationsgebiet der Strafaktionen „Maikäfer“ und „Adler“ die Dörfer Kostritschi, Kosulitschi, Kostritschskaja Slobodka, Borki im Kreis Kirowsk sowie die Dörfer Orechowka, Podstruschje, Wjasen und Selez im Kreis Klitschew niedergebrannt wurden. Dabei haben die Nazis etwa 3 000 Zivilisten gefoltert und getötet.
„Die Dörfer Wjasen und Selez teilten das Schicksal von Chatyn. Am frühen Augustmorgen umzingelte das Strafbataillon Dirlewanger die Dörfer. Die Bewohner wurden auf einen Kartoffelacker getrieben und gezwungen, ein großes Loch zu graben, dann wurden sie an den Rand dieses riesigen Grabes gestellt und mit Maschinengewehren erschossen. An diesem Tag wurden 140 Menschen begraben, und ihre Heimatdörfer wurden niedergebrannt“, sagt Julia Lyso. „Heute steht am Ort der Tragödie eine Gedenkstätte, die am 9. Mai 1985 eröffnet wurde. Aus der Vogelperspektive ähnelt sie einem Kreuz. Im Sommer 2021 wurde hier ein groß angelegter Wiederaufbau durchgeführt.“

Während des Krieges wurden im Kreis Klitschew 81 Dörfer vernichtet.
„Slawnys“ Weg
Die Sabotage- und Aufklärungseinheit „Slawny“ wurde am 15. Februar 1942 auf persönlichen Befehl von Pawel Sudoplatow, Leiter der Abteilung 4 des NKWD der UdSSR, gebildet. Es handelte sich um ein Sonderkommando, das aus 49 Personen bestand. Dazu gehörten nicht nur Bombenleger und Vertreter der staatlichen Sicherheit, sondern auch die besten Sportler des Landes: der Weltrekordhalter im Hantelnheben Nikolai Schatow, der siebenfache UdSSR-Meister im Rudern Alexander Dolguschin, der Moskauer Meister im Schwimmen Konrad Madej und viele andere berühmte Sportler. Sie verbrachten 15 Monate in der Region Brjansk und weitere 15 Monate in Belarus.
In Klitschew wurde Ende Juli 1943 die Einheit „Slawny“ gebildet, und bereits Anfang August schlossen sich ihre Kämpfer den Klitschewer Partisanen an – bei der Getreideernte und Beschaffung von Produkten für die Volksrächer und die Bevölkerung. Ihre Hauptaufgabe war jedoch der Kampf gegen den Feind. Dank dieser tapferen Männer wurden Dutzende von Garnisonen zerstört und feindliche Stellungen in die Luft gejagt. Sie organisierten Sabotageakte und Hinterhalte, holten die wichtigsten Informationen ein und übermittelten sie an das Zentrum.
Dank des Tagebuchs des Stabschefs von „Slawny“ - des 23-jährigen Michail Oborotow - gelang es den Historikern, den Weg der Einheit zu rekonstruieren, die sich acht Monate lang im Kreis Klitschew aufhielt. Bis 1944 war sie auf 300 Mann angewachsen. Die Faschisten setzten auf „Slawny“-Kämpfer ein fabelhaftes Kopfgeld aus.
Am 1. April 1944 machte sich die Einheit „Slwany“ auf den Weg nach Westen zu einem neuen Kampfeinsatz. „Jeder von uns wollte so sehr hier bleiben, in diesem Wald. Immerhin steht nur 30-40 Kilometer von uns entfernt unser Befreier, die Rote Armee. Wir mussten uns die ganze Zeit mit den sich zurückziehenden Deutschen nach Westen zurückziehen. So lautete der Befehl. Und wir hegten die Hoffnung, uns hier der Roten Armee anzuschließen und aufatmen zu können, in die Stadt zu kommen, mit dem Auto oder dem Zug zu fahren. Unbekleidet zu ruhen, im Bett, ohne Kontrollpunkte und Scheidungen. Aber unser Kommando vertraut uns und verlässt sich auf uns. Wir haben eine Aufgabe bekommen, und die müssen wir erfüllen“, schrieb der Kommissar.
P. Kriwonos Straße

Pawel Kriwonos wurde 1920 im Dorf Olchowka, Kreis Klitschew, geboren. Im Jahr 1943 absolvierte er die Saratower Panzerschule und wurde zum Zugführer des 253. Panzerregiments (4. Panzerbrigade der 3. weißrussischen Front) ernannt.
Er zeichnete sich bei der Liquidierung feindlicher Truppen bei Witebsk aus. Am 27. Juni 1944 deckte er den Panzer des Regimentskommandeurs mit seinem Panzer. Trotz seiner Verwundung führte er seinen Zug in den Kampf. Noch am selben Tag erlag er seinen Verwundungen. Für diese Leistung wurde Pawel Kriwonos posthum mit dem Titel Held der Sowjetunion ausgezeichnet. Eine Straße in Klitschew und die Mittelschule Nr. 1 tragen seinen Namen.
Witol Straße
Jan Witol wurde 1906 im Dorf Matuscha, Kreis Liosno, Witebsk, geboren. Nach einem Studium in Moskau kehrte er in das Heimatland zurück. Er arbeitete beim NKWD zunächst in Kostjukowitschi, dann in Klitschew. In den ersten Tagen des Großen Vaterländischen Krieges ging er zu den Partisanen. Er wurde einer der Organisatoren der 277. Partisaneneinheit, später wurde er zum Kompaniechef ernannt. Am 20. März 1942 wurde er in der Schlacht um Klitschew tödlich verwundet. Posthum wurde er mit dem Orden des Roten Banners ausgezeichnet, eine der Straßen von Klitschew trägt seinen Namen.
Sajaz Straße
Jakow Sajaz wurde am 19. März 1908 in Klitschew geboren. Ab Juli 1941 war er hinter den feindlichen Linien als Mitglied einer kommunistischen Gruppe im Untergrund tätig, ab November 1942 - Kommissar der 277. und 278. Partisaneneinheiten. Von April 1942 bis Mai 1944 war er Sekretär des Kreiskomitees der Kommunistischen Partei im Untergrund in Klitschew. Im Mai 1944 ging er in das sowjetische Hinterland. Er wurde mit dem Lenin-Orden und Medaillen ausgezeichnet. Er starb am 22. Oktober 1973. Eine der Straßen der Stadt trägt seinen Namen.
Djomin Straße
Als der Große Vaterländische Krieg begann, wurde Wassili Djomin zur Roten Armee eingezogen. Während des Rückzugs im Jahr 1941 blieb er in dem von den Deutschen eroberten Gebiet und ging zu den Volksrächern. Später leitete er einen Zug der Partisaneneinheit. Am 13. April 1943 zerstörte er mit seinem Zug zwei feindliche Feuerstellungen in den Dörfern Semjonowka und Makowka und führte einen Flankenangriff durch, der den Vormarsch des benachbarten Zuges sicherte. In einem weiteren Kampf am 1. Juni 1943 tötete er zwei Verräter und holte eine Trophäe ab. Er starb am 1. Mai 1944 in der Schlacht um Klitschew. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Spartak-Gasse in Klitschew in Djomin Straße umbenannt.
Julia Gawrilenko,
Foto: BELTA, Heimatkundemuseum Klitschew, Zeitung „7 Tage“